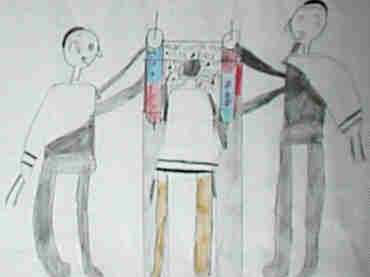
Der Sabbat
Der Sabbat ist bei den Juden ein heiliger Tag, ein Tag der Ruhe und der Freude. Er erinnert an die Schöpfung der Welt und daran, dass jeder von uns ein Geschöpf Gottes ist. Er erinnert auch daran, dass Gott selbst diesen Tag geheiligt hat, und daran, dass er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Der Sabbat wird im Ausblick auf das kommende Reich Gottes „Vorgeschmack der Ewigkeit" genannt. (Bei den Christen wurde der heiligste Tag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegt, weil an diesem Tag Jesus von den Toten auferstanden ist).
Am Freitag wird alles für den Sabbat vorbereitet. Das Haus wird aufgeräumt, so als ob man einen besonderen Besuch erwartet. Die Frauen geben sich viel Mühe mit dem Essen und backen die geflochtenen Weißbrote (siehe Vitrine). Der Sabbat beginnt am Freitagabend und geht bis zum Samstagabend, bis die Sterne zu sehen sind. Die Leute in den jüdischen Familien machen sich schick und sitzen friedlich beisammen. Der Tisch ist festlich mit einer weißen Decke und besonders schönem Porzellan gedeckt. Die Mutter zündet die Sabbat-Lichter (siehe Vitrine) an, meistens zwei, oft sind es so viele Kerzen wie Familienmitglieder. Sie sagt einen Segensspruch zum Sabbatbeginn. Alle begrüßen sich mit „schabbat schalom".
Auf dem Tisch stehen ein Becher mit Wein, der während der Feier viermal gefüllt wird, und die selbst gebackenen Zopfbrote. Der Vater spricht den Segen (Kiddusch) über den Wein, trinkt einen Schluck und reicht ihn an alle weiter. Der Wein ist ein Symbol der Freude darüber, dass Gott den Sabbat geschenkt hat. Dann segnet der Vater die Brote, zerteilt sie, bestreut sie mit etwas Salz und reicht jedem ein Stück. Dann erst beginnt das eigentliche Abendessen. Am Ende des Mahles wird Gott wieder gedankt.
Am nächsten Morgen ist Gottesdienst in der Synagoge, bei dem der Wochenabschnitt aus der Tora - sie umfasst die ersten fünf Bücher der Bibel - vorgelesen wird. Dazu können ein Mann oder mehrere Gemeindemitglieder aufgerufen werden. Der Text der Tora ist in großen Rollen in hebräischer Sprache aufgeschrieben. Gelesen wird von rechts nach links. Der Inhalt gilt als so heilig, dass die Seiten nicht mit den Fingern berührt werden. Man hilft sich beim Lesen mit einem silbernen Zeiger .
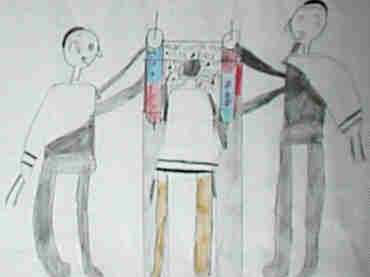
Jeder Jude sollte am Sabbat die Tora studieren und über das Gelesene nachdenken. Außerdem wird gespielt, diskutiert, mit Freunden gefeiert, geruht und spazieren gegangen. Aber alles soll in Ruhe gemacht werden. Man soll sich Zeit nehmen für Gott, für seine Mitmenschen und für sich selbst, deshalb darf am Sabbat nicht gearbeitet werden. Unter Arbeit wird jeder zweckgerichtete, planvolle, produktive „Eingriff" in die Welt verstanden, ganz gleich ob anstrengend oder nicht. Deshalb werden alle Speisen am Tag zuvor gekocht und warm gehalten.
Am Samstagabend wird der Sabbat mit einem besonderen Segensspruch (Hawdala) verabschiedet. Hawdala heißt Unterscheidung (zwischen dem heiligen Sabbat und dem Unheiligen der Woche). Auf dem Tisch stehen drei Dinge mit symbolischer Bedeutung: ein Becher mit Wein (siehe Vitrine), der so voll eingegossen ist, dass er überfließt. Er soll den überströmenden Segen Gottes für den Sabbat und die kommende Woche deutlich machen, eine Dose mit durchbrochenem Deckel (siehe Vitrine), in der duftende Kräuter sind. Der Duft soll die Menschen erfreuen und sie trösten, weil der Sabbat vorbei ist, und eine besonders geflochtene Kerze (siehe Vitrine). Sie erinnert an den ersten Schöpfungstag - den ersten Tag der Woche - mit dem das Licht begann.
"Gewalt
beendet keine Geschichte"
© 1999/2008 Kopernikus
Gymnasium Niederkassel