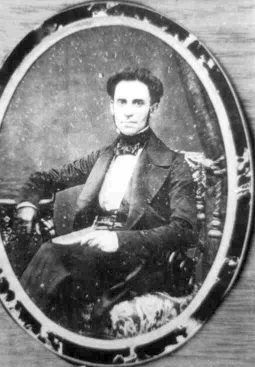
Heuman Coschman/Heinrich Kossmann
Heuman Coschmann wurde am 1. September 1813 als Sohn des Metzgers Coschman Jakob und seiner Ehefrau Rosetta Heuman* in Rheidt geboren. Er hatte drei Brüder und eine Schwester.
Der Lebensweg dieses Mannes zeigt exemplarisch die Emanzipation des Judentums, in dessen Hochphase er fällt. Aber nicht zuletzt sein ungewöhnlicher Aufstieg vom Sohn eines einfachen Landjuden in den Rang eines russischen Hofrates ist einer näheren Betrachtung würdig.
Nachdem der junge Heuman in Rheidt, Siegburg und Bonn verschiedene Schulen besuchte und im Alter von 15 oder 16 Jahren in Mannheim die Rabbinerausbildung durchlief, findet sich seine Spur im Dezember 1832 wieder, wo er sich als Student der Medizin an der Universität Bonn eingetragen hatte. Wenig später ging er nach Heidelberg , wo er sich die nächsten drei Jahre dem Studium der Naturwissenschaften widmetet.
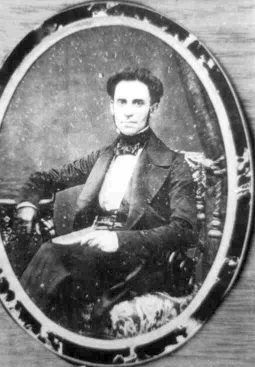
Coschmanns Studienzeit war für ihn sehr prägend. Besonders mit seinen jüdischen Mitstudenten verband ihn viel, gleichwohl er auch christliche Freunde hatte. Er knüpfte Beziehungen, die ihn den Rest seines Lebens begleiten sollten. Hier seien besonders Berthold und Jakob Auerbach hervorgehoben. Seine Freundschaft mit Moses Hess bestand noch aus früheren Jahren. Ein Vergleich der Biographien von Heuman Coschmann, Berthold Auerbach und Moses Hess zeigt drei Formen der Emanzipation des Judentums, auf die ich an späterer Stelle näher eingehen werde.
Moses Hess Erziehung fand im Haus seines Großvaters statt. Dieser lehrte seinen Enkel ausschließlich Religion. Nur richtete sich das Interesse des Jungen hin zu den Sozialwissenschaften. Er beschäftigte sich mit der Lektüre von Spinoza und Rousseau, machte sich Gedanken mit weltverbessernden Ansatz und brachte seine sozialistischen Utopien 1837 in seinem Werk "Die heilige Geschichte der Menschheit von einem Jünger Spinozas" zum Ausdruck.
Moses und Heuman schrieben sich einige Jahre Briefe, in denen sie ihre innigsten Gefühle zum Ausdruck brachten. Da von diesem Schriftverkehr nichts erhalten geblieben ist, lassen sich nur die Tagebuchaufzeichnungen von Moses Hess hinzuziehen. Hieraus kann man ablesen, daß sich Coschmann zu dieser Zeit in einer schweren Krise befand.
Da beide unterschiedliche Weltanschauungen besaßen, Heuman als Natur-, Moses als Sozialwissenschaftler, fehlte vermutlich die Diskussionsgrundlage. Daher liegt die Vermutung nahe, daß sie ausführliche Gespräche über das Judentum führten.
Nach diesem Besuch ist nichts von weiteren Kontakten zwischen Hess und Coschmann bekannt. Ihre Wege liefen weit auseinander. Weitaus stärker war die Beziehung, die Coschman mit Jakob und Berthold Auerbach unterhielt, die beide in Süddeutschland aufwuchsen.
Jakob promovierte 1836 in Tübingen und war seit den 40er Jahren Lehrer an einer jüdischen Hochschule in Frankfurt am Main sowie Hebräischlehrer am städtischen Gymnasium. Er genoß großes Ansehen als jüdischer Theologe und fand als reformfreundlicher Prediger immer gern Gehör.
Berthold Auerbach wurde Schriftsteller und brachte es in Deutschland mit der von ihm geschaffenen Gattung der Dorfnovelle zu Ansehen und Erfolg. Sowohl in Jakob als auch in Berthold erwachte schon früh ein liberaler Geist, nicht nur in der Politik sondern auch in der Auslegung des Judentums. Vor allem bei Berthold ist zu bemerken, daß sein Sinn nach einer Integration des Judentums in die christliche deutsche Welt strebte, nach einem gemeinschaftlichen Zusammenleben in einem liberalen Nationalstaat. So war die Gründung des Nationalstaates im Jahr 1871 für ihn ein Ereignis von besonderer Bedeutung, und selbst der sich über das Land ausbreitende Antisemitismus in den 70er Jahren änderte nichts an seinen Auffassungen. Was die unterschiedliche Religionsauffassung anbelangt, so ist eine Betrachtung der Beziehung zwischen Hess und Berthold Auerbach von Interesse, die 1835 wahrscheinlich unter Vermittlung von Coschman miteinander in Kontakt kamen. War Hess in seinen revolutionären 40er Jahren eher gleichgültig gegenüber seinem jüdischen Glauben, so wandelte sich sein religiöses Weltbild nach der "Verschmähung" durch seine ehemaligen sozialistischen Weggefährten Karl Marx und Friedrich Engels. Er wandte sich den Naturwissenschaften zu und bat Berthold Auerbach, ihm bei der Publikation eines Buches zu helfen (1856). Elf Jahre zuvor ist es zwischen den beiden Männern zum Streit gekommen, da beide kein Verständnis für die politische Auffassung des anderen zeigten. Auerbach konnte sich nie mit der radikalen Einstellung von Hess identifizieren.
In dem angesprochenen Buch, "Rom und Jerusalem" , das 1862 erschien, befürwortet Hess die Wiederherstellung eines jüdischen Staates. Nachdem Auerbach jedoch die Hälfte des Manuskriptes las, das ihm geschickt wurde, zog er erschüttert einen endgültigen Schlußstrich unter seine Freundschaft mit Hess: Sich selbst einen "germanischen Juden" nennend wies er Hess Anschauung des Judentums zurück und weigerte sich, ihm bei der Publikation seines Buches behilflich zu sein.
Doch wie entwickelten sich die Auffassungen von Heuman Coschmann? Seit 1833 war er Hauslehrer zweier Mädchen, deren Mutter zum Christentum übergetreten ist. Zu dieser Familie pflegte er eine innige Beziehung. Die Vermutung liegt nahe, daß Heuman, geprägt durch den Umgang mit der gebildeten, idealistischen Regine Jolberg, in diesen Jahren den Entschluß faßte, zum Christentum überzutreten.
Anfang 1836 knüpft Coschmann Kontakt zu einer Frau, die sein Schicksal indirekt entscheidend beeinflussen sollte: Christine Eschscholtz. Sie war in Begleitung einer Freundin und ihres Sohnes auf der Durchreise in Heidelberg. Im Herbst 1836 jedoch zog es sie wieder zurück in die Heimat ihres verstorbenen Mannes, die im Baltikum liegende Universitätsstadt Dorpat. Heuman folgte ihr und wurde im Herbst 1836 in "Des großen Friedrichs Waisenhaus" auf den Namen Heinrich getauft².
Hier in Dorpat setzte Heinrich sein Studium fort und wurde Mathematiklehrer. Nachdem der Sohn von Christine Eschscholtz starb, zog es sie zurück nach Heidelberg, und wieder wurde sie von Heinrich Kossmann begleitet. Doch sein Aufenthalt in Heidelberg sollte nicht von Dauer sein. Christine Eschscholtz ermöglichte es ihm, seine Ausbildung in der französischen Schweiz und in Paris zu vollenden.
Im Herbst 1839 ging er zurück nach Dorpat. Dort bestand er die Universitätsprüfung für das Amt eines Oberlehrers. Nach einem erneuten Zwischenspiel in Deutschland, wo er 1839 Gießen das Doktordiplom erhielt, ging er zurück nach Rußland, wo er mit einer Unterbrechung die nächsten 23 Jahre verbringen sollte.
Am 16. September 1840 wurde er wurde er als Mathematik- und Physiklehrer an der Sankt - Petri - Schule in Petersburg engagiert. Damit trat er in russischen Staatsdienst und verlor seine preußische Nationalität.
In dieser Gegend, in der Kossmann fortan als Lehrer fungierte, befand sich eine erstaunliche Anzahl schon seit einiger Zeit in Estland und Lettland ansässiger Deutscher, die akademisch gebildet war Rußland bewahrte.
Schon kurze Zeit, nachdem er in Petersburg begann, seinen Beruf als Lehrer auszuüben, wurde Kossmann von der Großfürstin Helene, Schwägerin des Zaren Nikolaus I., zum Lehrer ihrer drei Töchter ernannt. Heinrich bewunderte die liberal eingestellte, junge württembergische Prinzessin, die sich sozial sehr engagierte. 1843 nahm die Großfürstin Heinrich als ihren Sekretär mit nach Deutschland, wo wahrscheinlich die Vermählung ihrer siebzehnjährigen Tochter Elisabeth mit dem Herzog von Nassau vorbereitet wurde. Kossmann nutzte die Zeit, in der er sich in Deutschland aufhielt, um seine alten Freunde sowie sein Elternhaus in Rheidt aufzusuchen. Dort wurde er mit viel Wärme empfangen, woran man ablesen kann, daß sein Übertritt zum Christentum nicht als unverzeihlicher Verrat betrachtet wurde.
Nach seiner Rückkehr aus Deutschland widmete sich Kossmann verstärkt der Gründung einer Familie und seinem Beruf als Lehrer.
Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger, ist in Rußland ein heftiger Meinungsstreit über den Inhalt des Lehrplans entfacht. Kossmann beteiligte sich an der Diskussion und war der Auffassung, daß die Naturwissenschaften einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildung des Charakters eines jungen Menschen leisteten. Gleichwohl hob er die Wichtigkeit des Studiums des klassischen Altertums hervor, war jedoch der Meinung, daß dies für Rußland nicht der geeignete Weg sei, da zu viele Unterschiede in den Verhältnissen zwischen Mittel- und Westeuropa bestünden.
Als im Jahr 1866 der konservative Unterrichtsminister Dimitri Tolstoi sein Amt antrat, war das Bemühen der Befürworter einer Reform vergebens. Tolstoi vertrat die Auffassung, daß die Naturwissenschaften zum Materialismus führten, und so verstärkte er die Präsenz der klassischen Wissenschaften in den Unterrichtsplänen, so daß selbst für das Studium der modernen Sprachen nicht mehr viel Platz blieb.
Diese Entwicklung sollte Kossmann als Bürger Rußlands nicht mehr erleben, da er 1863 Rußland verließ und sich ein Haus in Karlsruhe kaufte. Vermutlich wurde seine Entscheidung durch einen schweren Schicksalsschlag herbeigeführt, den er 1861 zu verkraften hatte. Irgendwann, nachdem er 1840 in Rußland angekommen war, lernte Kossmann die in Dorpat geborene und aus einer Theologenfamilie stammende Mathilde Sophie Moritz kennen. Sie führten 16 Jahre lang eine glückliche Ehe und wurden am 27. Oktober 1861 Eltern ihres neunten Kindes (drei starben früh), Ernst Ferdinand.
Nach dem frühen Tod von Kossmanns Frau (sie wurde nur 37 Jahre alt), schrieb ihm sein alter Freund Berthold Auerbach einen gefühlvollen Brief.
Heinrich Kossmann sollte jedoch nicht lange allein bleiben, denn er heiratete weniger als ein Jahr nach dem Tod von Mathilde Sophie erneut: Alexandra Struve hieß die Frau, mit der er bis zu seinem Tod zusammenblieb und die zwei Jahre nach ihm starb. Die Ehe war kinderlos.Im Juni 1863 endete Kossmanns Engagement in Rußland. Er legte sein Lehramt nieder und kehrte nach Deutschland zurück, wo er sich ein Haus in Karlsruhe kaufte. In diesem Haus führte Kossmann eine Pension, in der zeitwährend ein reger Betrieb herrschte. Seine "Berufung" als Lehrer gab er übrigens keineswegs auf. Er gab 11 Jahre lang unentgeltlich Unterricht an einer Ausbildungsstätte für Lehrerinnen.Kossmann blieb seinen liberalen Auffassungen treu. Er bewunderte Bismarck und war ein Gegner des Sozialismus. Die technischen Innovationen seiner Zeit stellten für ihn ein Ereignis von epochaler Bedeutung dar.
Heinrich Kossmann ist ein typischer Vertreter des optimistischen, nach Fortschritt strebenden, emanzipierten Judentums. Er wählte keinen einfachen Weg, aber er ist Lehrer geworden aus Leidenschaft, um den Charakter junger Menschen positiv zu beeinflussen, sie zu erziehen, um so seinen Beitrag für den Fortschritt der jeweiligen Gesellschaft zu leisten, in der er lebte.
*Heuman Coschmanns Name verschafft ein gutes Beispiel für die Namengebung der Juden. Der Neugeborene erhielt ebenso wie sein Vater zwei Namen, die sich aus dem Namen seiner Eltern zusammensetzen. Hierbei ist zu beachten, daß zu dieser Zeit noch nicht die Namengesetzgebung für Juden galt. Sie trat in dieser Gegend erst 1845/46 in Kraft und empfahl den Juden Familiennamen anzunehmen.Interessant ist auch zu sehen, wie sorglos man in jener Zeit mit den Namen umgegangen ist. Heuman Coschman erhielt in seinem zweiten Namen zwei "n", sein Vater nur eines. Auch der Name Coschman ist auf eine Undeutlichkeit in der Aussprache zurückzuführen. Es müßte Cossmann heißen. Bei der Geburt seines ersten Sohnes sprach Coschman Jakob noch undeutlicher und so wurde sein Name als Corschmann in den Akten verzeichnet.
²Übertritte zum Christentum waren zu dieser Zeit nichts ungewöhnliches, da sich viele Juden materielle Vorteile vom Religionswechsel versprachen. Bei Heinrich Kossmann weiß man jedoch sicher, daß er diesen Schritt aus Überzeugung tat.
Heinrich Kossmann reiste 1838 das erstemal nach Russland, in die baltische Universitätsstadt Dorpat. Einige Jahre später wurde er Lehrer an der Sankt-Petri-Schule in St. Petersburg. Von seinem Geburtsort aus ist diese Stadt etwa 1800 Kilometer Luftlinie entfernt. Für die damalige Zeit ist dies eine ungewöhnlich große Entfernung, zumal er diese Strecke aufgrund von gelegentlichen Abstechern nach Deutschland mehrmals bewältigen mußte.
| Die Angaben zu Heuman Coschmann verdanken wir seinem Nachfahren Prof. Heinrich Kossmann (im Bild links bei einem Besuch auf dem jüdischen Friedhof Mondorf). | 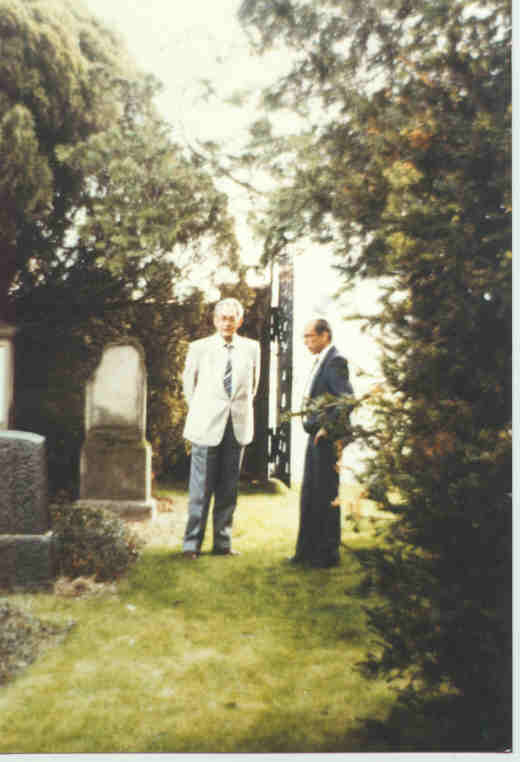 |
"Gewalt beendet keine
Geschichte"
© 1999 Kopernikus Gymnasium Niederkassel
Kontakt: gbkg@koperngymndk.su.nw.schule.de